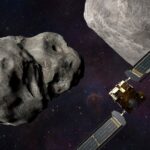Am 21. April 1922 fand im Unterhaltungsetablissement Pôle Nord in Stadt Luxemburg die Uraufführung der Operette „An der Schwemm“ von Lou Koster (1889-1973) statt. Batty Weber (1860-1940) hatte das Libretto geliefert. Erste Kritiken erschienen gleich am Tag nach der Uraufführung in der Luxemburger Zeitung, im Escher Tageblatt sowie auf der Titelseite in L’Indépendance luxembourgeoise und bekundeten den großen Publikumszustrom und den Erfolg des Werkes.
Theaterregie führte August Donnen, der auch eine der Hauptrollen (Zengerle’) übernahm. Von Beruf Friseur, genoss er als Sänger und Schauspieler bereits vor dem Ersten Weltkrieg große Popularität. Donnen nahm das Lidd vum Zengerle’ in den 1920er Jahren auch für die Berliner Firma Homokord auf Schellackplatte auf, behielt es in seinem Repertoire und trug somit zur Popularität des Werkes bei. Die Rolle des Reddy spielte der Sänger Charles Kaboth. Die restliche Truppe setzte sich aus Amateurschauspieler:innen aus dem Kreis des Swimming Club Luxembourg zusammen. So wurde die Hauptrolle der Lori von der Schwimmerin Anne Kugener gesungen und die der Miss von Laure (oder auch Lori) Koster.

Die Hauptprotagonistin trägt nicht nur zufällig den Namen von Lou Kosters Schwester. Diese Namensgebung versteht sich als eine Hommage Batty Webers an die zu diesem Zeitpunkt über die Grenzen Luxemburgs hinaus bekannte Wettschwimmerin, Laure Koster, die ebenso gut Cello spielte wie schwamm. 1924 vertrat sie Luxemburg auf der Olympiade in Paris. Zwischen den Wettschwimmen übte sie für ihr Examen am Konservatorium in Brüssel.
Die Handlung der Operette spielt an dem Tag, an dem Lori sich unter der Aufsicht ihres Schwimmlehrers, des Obergefreiten Reddy, freischwimmen soll. Reddy fehlt der Mut, der jungen Frau seine Liebe zu gestehen. Lori beschließt, die Initiative zu ergreifen. Die Haupthandlung von „An der Schwemm“ ist mit einer komischen Nebenhandlung verwoben: Lori hat einen zweiten Verehrer, den alten Zengerle’, eine gute Partie mit „eigenem Haus und schönen Renten“. Zengerle’ verschafft sich am Damenschwimmtag unerlaubt Zutritt ins Bad und lauert Lori mit seiner „Kodak“ auf. Der Voyeur wird von Loris Schwimmfreundinnen entdeckt, die sich über das Fotografieren ärgern: „Die Beine, auf denen wir stehen, das sind gewissermaßen unsere Beine, und die lassen wir nicht mir nichts dir nichts von so einem … so einem knipsen!“ Die Frauen werfen Zengerle’ kurz entschlossen ins Wasser. Der Beschämte flüchtet in seine Kabine und stellt fest, dass seine Kleider gestohlen wurden. Die abgenutzten, die er vorfindet und anzieht, gehören dem flüchtigen Gefängnisinsassen Struppes. Zengerle’ in Struppes’ Kleidung wird von der Polizei festgenommen und abgeführt. Der stereotypische Vertreter einer überkommenen Männerrolle wird hinter Schloss und Riegel gebracht.
Komponistin und Dichter bringen in dieser Operette die „Neue Frau“ der 1920er Jahre auf die Bühne, die selbstständig und selbstbewusst nach geistiger wie körperlicher Freiheit strebt. Den Wunsch nach Emanzipation inszenierten die beiden aber nicht nur auf der Bühne: Lou Koster hatte, zusammen mit ihrer Mutter, 1918 ihren Namen unter eine Petition gesetzt, die das Wahlrecht für Frauen forderte, das 1919 in Luxemburg auch eingeführt wurde. Weber, der mit der über die Grenzen Luxemburgs hinaus bekannten Frauenrechtlerin Emma Brugmann verheiratet war, setzte sich in seinem „Abreißkalender“ häufig (wenn auch nicht immer) anerkennend mit der Frauenemanzipation auseinander.
Freischwimmen als Metapher
Danielle Roster ist Musikwissenschaftlerin und arbeitet als Forscherin an der Universität Luxemburg, wo sie zusammen mit Sonja Kmec und Anne Schiltz das Projekt MuGi.lu betreut. Sie hat 2019 im Böhlau Verlag, als Band 10 der Reihe Europäische Komponistinnen, die Biographie „Lou Koster – Komponieren in Luxemburg“ veröffentlicht (456 S.).
Der Dichter versteht das Thema Freischwimmen als Metapher für ein eigenverantwortlich emanzipatorisches Handeln, das zur Befreiung der Frau aus den Fesseln ihrer bürgerlich-häuslichen Rolle führt. In dem gemischten Chor der Schwimmerinnen und Schwimmlehrer (14. Szene) einigen sich beide Geschlechter singend in einem emanzipatorischen Manifest: „Könnte man doch überall / Wie im Wasser frei sich schwimmen“. Lori wird vom Chor ermutigt, sich von der (männlichen) „Leine“ – konkret hier die Schwimmleine – zu lösen, sich in jeden Strom zu wagen – und also auch gegen den Strom zu schwimmen –, um endlich frei und ohne „Zwang“ zu sein. Dadurch, dass die Komponistin in der Partitur aber den Chor als „Rêverie Cho’er“ (Traum-Chor) betitelt, bringt sie eine gewisse Skepsis zum Ausdruck: Wird dieser Wunsch nach Gleichberechtigung nicht lange noch nur ein „Traum“ bleiben, der zwar auf der Operettenbühne besungen wird, aber wenig Potential hat, die Wirklichkeit zu verändern?
Auch im Liebesduett von Lori und Reddy (15. Szene) stellen Komponistin und Dichter traditionelle Geschlechterrollen auf den Kopf. Der scheue Reddy besingt seine Liebe zart im pianissimo und wünscht sich, dass Lori ihm ihre Gegenliebe leise, heimlich ins Ohr flüstere, während Lori der „ganzen Welt“ laut und deutlich – im forte in Webers Libretto, im fortissimo in Kosters Partitur – ihre Liebe verkündet. Kann das euphorische Besingen einer Befreiung der Frau auf der Bühne einen Beitrag dazu leisten, die Weichen für eine tatsächliche politische, gesellschaftliche und kulturelle Gleichberechtigung zu stellen? Die junge Hauptprotagonistin Lori kommt am Schluss doch ‚unter die Haube‘, auch wenn sie sich ihren Partner selbst ausgewählt hat.

Der Ort der Handlung – die „Schwemm“ – war das damals real existierende städtische Flussschwimmbad „am Bisserwee am Gronn“ zwischen Pulvermühle und Stadtgrund. Die preußische Garnison hatte hier Mitte des 19. Jahrhunderts eine Schwimmschule gegründet. Als diese 1867 abzog, erteilten Unteroffiziere und Soldaten des luxemburgischen Militärs dort bis 1918 Schwimmunterricht. Lou Koster war die „Schwemm“ bestens vertraut, da sie selbst eine begeisterte Schwimmerin war. Sie war Mitglied des Swimming Club Luxembourg, nahm an Damenwettschwimmen teil und untermalte aber auch die Schwimmfeste musikalisch mit dem von ihr geleiteten, über den Duschkabinen platzierten, kleinen Frauenorchester.
Nach Kosters Tod galt das musikalische Aufführungsmaterial samt der Orchesterpartitur als verschollen, die Nationalbibliothek besaß lediglich einen handschriftlichen Klavierauszug. Im Rahmen meiner Forschungsarbeit zu Lou Koster fand ich auf einem Privatspeicher große Teile des Aufführungsmaterials (heute in der Nationalbibliothek) wieder. Erhalten waren nun, neben weiteren Klavierauszügen, die kompletten Orchesterstimmen aus dem Jahr 1927, was die Rekonstruktionsarbeit einer Gebrauchsedition ermöglichte. So konnte 2024 „An der Schwemm“ in einer modernen Inszenierung von Marion Rothhaar und unter der künstlerischen Leitung von Jonathan Kaell von Opera Mobile wieder aufgeführt werden.
MuGi.lu (Musik und Gender in Luxemburg), ein Projekt der Universität Luxemburg, erforscht, sammelt und vermittelt Wissen über Musikschaffen mit besonderem Fokus auf Geschlechterverhältnisse. Es umfasst mittlerweile neun digitale Portale (www.mugi.lu). Das Portal zur Operette „An der Schwemm“, von der es bis heute keine Tonaufnahme gibt, enthält die einzig existenten Musikaufnahmen – darunter eine Schellackplatte der 1920er Jahre, Fotos, Noten, Korrespondenzen zwischen Weber und Koster, Presseausschnitte, und vieles mehr. MuGi.lu verfügt des Weiteren über ein digitales Archiv zu Leben und Werk von Lou Koster. (Kontakt: [email protected])