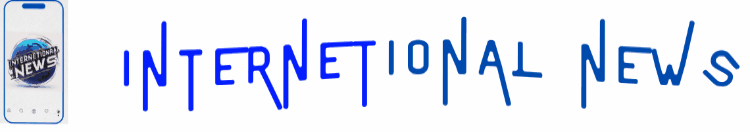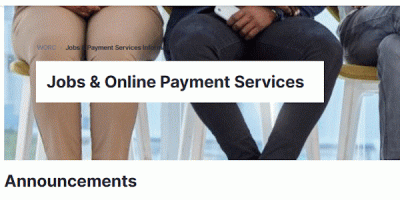Tesla hat erneut weniger Elektroautos verkauft als im Vorquartal. Noch kann Firmenchef Elon Musk die Investoren mit der Aussicht auf selbstfahrende Taxis und humanoide Roboter einigermassen bei Laune halten. Aber wie lange noch?

Elon Musk steht bei Tesla vor einer schwierigen Aufgabe.
Kirsty Wigglesworth / AP
Der Tesla-Investor lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Elons geht: Dieses hat Anlegern, die in den amerikanischen Elektroauto-Konzern investiert haben, schon immer als Richtschnur gedient.
Und tatsächlich wurden sie für ihren Glauben bisher reich belohnt. Wer seine Tesla-Aktien vor fünf Jahren kaufte und bis heute hielt, hat seinen Einsatz um mehr als das 15-fache erhöht.
Schlechte Zahlen aus Austin
Nun aber wird der Glaube der Musk-Jünger schwer geprüft. Tesla hat am Dienstagnachmittag amerikanischer Zeit zum wiederholten Mal schlechte Quartalszahlen abgeliefert. Zwar stieg der Umsatz des Autoherstellers um 2,2 Prozent im Vorjahresvergleich, auf 25,5 Milliarden Dollar.
Der Zuwachs ging jedoch in erster Linie auf die Batterie- und Energie-Sparte von Tesla zurück. Rund 890 Millionen Dollar hat Elon Musk der ihm verhassten Biden-Administration zu verdanken: Andere Autobauer, die zu viele Benzinfresser produzieren und deshalb ihr CO2-Kontingent überschreiten, müssen Tesla Verschmutzungsrechte abkaufen.
Mit dem Verkauf von Autos erzielte Tesla nur noch einen Umsatz von 19,9 Milliarden Dollar – im Vorjahr waren es noch 21,6 Milliarden. Der Quartalsgewinn sackte auf 1,5 Milliarden Dollar ab (im Vorjahr: 2,7 Milliarden) und lag damit noch unter den eher bescheidenen Erwartungen der Investoren.
Die schlechten Nachrichten ereilten die Anleger kurz nach Börsenschluss. Im nachbörslichen Handel sank der Kurs der Tesla-Aktie, die schon während der offiziellen Handelszeiten an Wert verloren hatte, um fast 8 Prozent. Damit lag er allerdings noch immer deutlich höher als Anfang Juni.
Teslas Vorsprung schmilzt
Tesla kämpft an mehreren Fronten. In den USA hat der Verkauf von Elektroautos 2024 nur noch gemächlich zugenommen; jedenfalls langsamer, als es Branchenexperten einst vorhergesehen haben. Vielen Amerikanern sind die Elektroautos noch immer zu teuer im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennern.
Zudem hat Tesla im Heimmarkt, den es lange im Griff hatte, Marktanteile an die Konkurrenz verloren. Gemäss Zahlen des Auto-Vermarkters Cox Automotive hat Tesla im zweiten Quartal 2024 erstmals weniger als die Hälfte aller Elektroautos verkauft. In- und ausländische Autobauer, aus China aber auch aus Europa, haben einen scharfen Preiskampf angezettelt.
Tesla hat zwar auch die Preise für seine eigenen Autos vielerorts gesenkt, konnte aber dennoch nicht verhindern, dass Kunden zur Konkurrenz abwandern. Gleichzeitig führten die Preisnachlässe dazu, dass die Betriebsmarge, lange der Stolz von Tesla, von 9,6 auf noch 6,3 Prozent zusammenschmolz. Ein Fokus auf die Herstellungskosten ist nötig. Der Autobauer hat angekündigt, mehr als jede zehnte Stelle weltweit abzubauen. Das könnte die Profitabilität Teslas stützen, jedoch nicht von heute auf morgen.
Insbesondere die chinesischen Autobauer, angeführt von BYD, setzen Tesla stark zu. In China, dem mit Abstand wichtigsten Markt für Elektrofahrzeuge, kaufen immer mehr Kunden einheimische Vehikel statt einen Tesla. In Europa steht Musks Unternehmen ebenfalls unter Druck.
In den USA kann er zwar auf die Politik hoffen: Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner wollen gegenüber China Härte signalisieren und dessen Elektroautos mit enorm hohen Importzöllen aus dem Heimmarkt fernhalten. Davon wird Tesla profitieren. Aber auch ohne BYD bleiben genug Konkurrenten übrig, die Tesla die Marktanteile streitig machen. Tesla kämpft damit, dass seine Verkaufsschlager, die Modelle 3 und Y, in die Jahre kommen. Neue und vor allem preiswerte Modelle sind nötig, um mitzuhalten.
Das Robotaxi lässt auf sich warten
Elon Musk hat vor einiger Zeit schon erkannt, dass Tesla seine einzigartige Stellung im amerikanischen Elektroauto-Markt nicht auf Ewigkeit wird halten können. Also will er das Unternehmen radikal umkrempeln. Er baut die Zukunft Teslas auf künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und vor allem auf Robotaxis.
Dabei handelt es sich um selbstfahrende Fahrzeuge, die Tesla-Kunden gehören, von diesen aber oft nicht selbst gefahren, sondern als Taxi genutzt werden. Die Autos würden selbständig in Städten herumkurven und Passagiere von A nach B kutschieren, und dabei Einkommen für den Autobesitzer und Tesla generieren.
Die Anleger sind begeistert ob Musks Vision. Die Aktie hat seit Juni um mehr als ein Drittel an Wert zugelegt – seit der Firmenchef etwas genauer geschildert hat, wie das Robotaxi-Geschäft funktionieren soll. Seither hat Tesla eine anberaumte Präsentation des Robotaxis aber nach hinten verschoben; statt Anfang August will man das Gefährt nun erst im Herbst vorstellen. Design-Änderungen an der Frontpartie seien der Grund, hiess es.
Im Telefongespräch mit Investoren sagte Musk am Dienstag, dass der Wert von Tesla überwiegend auf dem Geschäft mit autonomen Fahrzeugen basiere. Noch aber sind diese Autos nicht da, und Tesla benötigt die Gewinne aus dem herkömmlichen Geschäft mit Elektrofahrzeugen, um die Entwicklung der Robotaxis zu finanzieren.
Benziner bleiben beliebt
Das Malaise von Tesla tritt deutlich zutage, wenn man den Autobauer mit einem Konkurrenten vergleicht, der am Dienstag ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt haben: General Motors, der Traditionskonzern aus Detroit, profitiert derzeit davon, dass die US-Autokäufer nicht so schnell auf Elektroautos umsteigen wie noch vor einem Jahr gedacht.
Besonders die grössten Benzinschlucker von GM verkaufen sich sehr gut und spülen Gewinne in die Firmenkasse, mit denen man vor zwei drei Jahren, als die grüne Welle ihren Höchststand erreichte, nicht unbedingt rechnen konnte. GM zögert daher die Inbetriebnahme einer neuen Fabrik für Elektro-Trucks im Heimatstaat Michigan weiter hinaus. Konkurrent Ford geht ähnlich zögerlich vor.
Anders als Tesla kommt es GM gelegen, dass sich die Amerikaner Zeit lassen mit dem Umstieg von Benzinern auf Elektroautos. Mit jedem traditionellen SUV, den General Motors in den USA derzeit verkauft, verdient der Konzern viel Geld.
Derweil wird die Tesla-Aktie noch immer sehr hoch gehandelt; bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 60. Die Anleger brauchen viel Geduld, und müssen darauf vertrauen, dass Elon Musk mit seiner Genialität und seinen Robotaxis einmal mehr für sie die Kohlen aus dem Feuer holt.